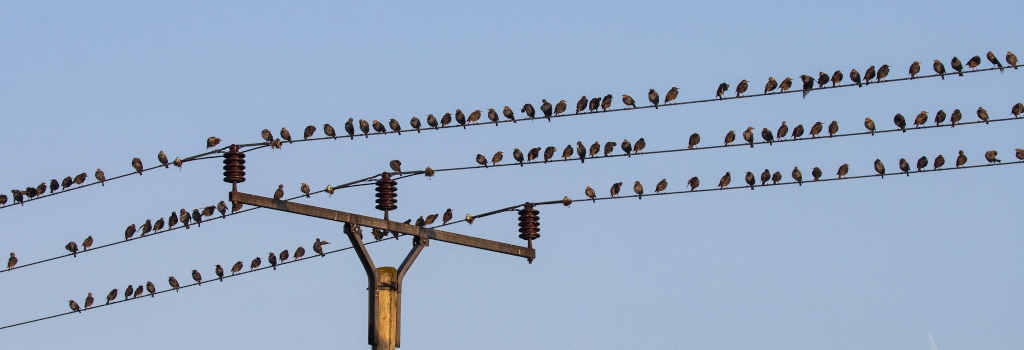Aktuelle Meldungen
04.02.2026
Neue Meldeliste für die Dokumentation von Seltenheiten bei der AviKom
Die Beobachtung seltener Vogelarten sind nicht nur das Salz in der Suppe der Vogelbeobachtung, ihre Dokumentation zeigt spannende Veränderungen in der Vogelwelt auf. Einst extrem seltene Arten tauchen heute häufiger auf, andere werden vom Brutvogel zur absoluten Ausnahmeerscheinung.
Aus diesem Grund wird auch die Meldeliste unserer Avifaunistischen Kommission (AviKom) regelmäßig angepasst, um aktuellen Entwicklungen Rechnungen zu tragen. Dies soll zukünftig in regelmäßigen Abständen von fünf Jahren passieren, so dass zwischendurch gleichzeitig auch eine gewisse Konstanz gewahrt bleibt, auf die sich Beobachtende einstellen können. Vorher aber, wurde die Meldeliste nun noch einmal angepasst. Dies geschah rückwirkend zum 01.01.2025.
Die Änderungen sind überschaubar, nichts destotrotz betreffen sie einige gut bekannte und charismatische Arten. Neu „meldepflichtig“ sind Nebelkrähe, Wanderfalken der Unterart Falco peregrinus calidus und Karmingimpel. Gerade die Bestimmung der ersten beiden ist nicht einfach, da es bei Nebelkrähen oft Hybriden gibt und phänotypisch eindeutige hochnordische Wanderfalken über ein „mit Merkmalen von“ hinaus erstaunlich selten dokumentiert worden. Nicht mehr dokumentiert werden müssen Eistaucher, Kuhreiher, Steppenweihe und die Raubseeschwalbe. Hier gelingen mittlerweile so regelmäßig Beobachtungen, dass zumindest bis auf Weiteres von einer Einreichung bei der AviKom abgesehen werden kann. Noch nicht eingereichte Beobachtungen bis zum 31.12.2024 sollten aber unbedingt nachgereicht werden. Und selbstverständlich sollten Beobachtungen dieser nicht meldepflichtigen Arten auch weiterhin auf ornitho.de dokumentiert werdnen. Hier ist es ausdrücklich erwünscht, Belegfotos hochzuladen und eine sorgfältige Beschreibung im Bemerkungsfeld zu hinterlegen, die die Beobachtung eindeutig macht und eine Verwechslung ausschließt. Bitte schreiben Sie dort nicht nur, dass Sie eine Art kennen, sondern geben Sie die tatsächlich von Ihnen festgestellten Merkmale an.
Die aktuelle Meldeliste kann hier heruntergeladen werden. Wir drücken die Daumen, dass auch Sie Glück haben und die ein oder Ausnhameerscheinung in nächster Zeit beobachten können.
02.02.2026
Welttag der Feuchtgebiete
Heute ist Welttag der Feuchtgebiete. Am 02. Februar 1971 wurde in der iranischen Stadt Ramsar das Übereinkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, unterschrieben. Deutschland trat fünf Jahre später bei und feiert im Jahr 2026 die 50-jährige Unterzeichnung.
Feuchtgebiete gehören zu den produktivsten Lebensräumen der Erde, sie halten das Wasser für Trockenzeiten, wirken mäßigend auf das Klima, speichern CO2, sind Erholungsräume, essentiell für Land- und Forstwirtschaft und vor allem Hotspots der Artenvielfalt. Weltweit die Zahl der Feuchtgebiete durch menschlichen Einfluss leider immer weiter ab und viele sind stark geschädigt.
In NRW wurden drei Gebiete als Ramsargebiet von internationaler Bedeutung gemeldet: der Untere Niederrhein, die Rieselfelder Münster und die Staustufe Schlüsselburg. Blicken wir auf den Zustand der Feuchtgebiete in unserem Bundesland insgesamt, wurden auch bei uns Moore großräumig entwässert, Flüsse begradigt und noch so kleine Feuchtstellen, Tümpel und Teiche sind trockengelegt worden und der Grundwasserspiegel wurde fast überall abgesenkt. Das alles sind Prozesse, die keineswegs überall gestoppt wurden, zumal die Klimakrise als weiterer Gefährdungsfaktor hinzugekommen ist.
Auf den Roten Listen finden sich daher wenig überraschend viele Feuchtgebietsbewohner wie die Bekassine in den höchsten Kategorien wieder. Bekassinen waren einst fast flächendeckend als Brutvögel bei uns verbreitet und fehlten auch im Mittelgebirge nicht. Heute leben in NRW nur noch wenige Brutpaare in wenigen sehr nassen Mooren und Feuchtwiesen.
Die gute Nachricht ist, dass Wiedervernässungen und Renaturierungsprojekte nicht selten schon nach kurzer Zeit Erfolg haben und manche bedrohte Art rasch wiederkommen kann. Leider sind es noch viel zu wenige Projekte und die Umsetzung erfolgt oft nicht konsequent genug und die Flächen sind dementsprechend oft zu klein, um den hochgradig bedrohten Arten besser zu helfen. Bei einigen Arten hält die Bestandsabnahme daher weiter an oder eine Wiederbesiedlung wie sie in benachbarten Regionen längst stattgefunden hat, bleibt in NRW aus. Es bleibt also viel zu tun!
Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich an unseren Monitoringprogrammen beteiligen, die wichtige Grundlagen über den ökologischen Zustand unserer Gewässer und iherer Bewohner liefern. Das Monitoring seltener Brutvögel der Binnengewässer ist gerade in überschaubaren Gebieten wie Seen und Parkgewässern ein ideales Einstiegsmodul, an Fließgewässern lassen sich Eisvogel, Wasseramsel und Gebirgsstelze bereits mit zwei Spaziergängen im Frühjahr erfassen. Jetzt ist die richtige Zeit, sich dazu bei uns zu melden, denn die Zählsaison startet in Kürze. Wer lieber Rastvögel erfassen möchte, kann sich beispielsweise an der Wasservogelzählung beteiligen. Der Schwerpunkt der Erfassungen liegt von September bis April, aber ein Einstieg ist jederzeit möglich. Scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden!
27.01.2026
Start in die Rebhuhnsaison
Wie kaum eine andere Art steht das Rebhuhn für die Artenvielfalt offener landwirtschaftlich genutzter Lebensräume in Nordrhein-Westfalen. Einst waren die Vögel nahezu flächendeckend auf Feldern und im Grünland verbreitet. Um ihr Vorkommen und ihre Bestandsentwicklung zu überwachen, gibt es ein spezielles Modul in Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel. Aufgrund seiner Einfachheit ist es besonders für den Einstieg geeignet.
Rebhühner zeigen einige ökologische Besonderheiten, die für die Erfassung der Art eine Herausforderung darstellen. Rebhühner sind vor allem im zeitigen Frühjahr sehr rufaktiv, wenn manch andere Art noch wenig aktiv ist. Die Lautäußerungen werden außerdem meist nur in einem sehr kurzen Zeitraum in der Dämmerung geäußert. Die Paare finden sich in dieser Zeit des Jahres, die Brut und Jungenaufzucht finden allerdings erst im späten Frühjahr und Sommer statt. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Erfassung über ein eigenes Modul für das Rebhuhn im Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel, das auch in NRW umgesetzt wird. Geeignet sind alle Regionen, in denen noch mit Rebhühnern gerechnet werden kann.
Die Methodik ist recht einfach und wenig aufwändig, daher ist dieses Programm auch für Personen mit wenig Zeit geeignet und ein echtes Einstiegsprogramm. Es ist nur eine Begehung zwischen Ende Februar und Ende März erforderlich. Die Erfassung erfolgt entlang einer zuvor festgelegten Zählroute von ein bis anderthalb Kilometern mit Hilfe einer Klangattrappe im Zeitraum von 30 Minuten nach Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang, dauert also nur eine halbe Stunde. In dieser Zeit ist die Rufaktivität der Rebhühner in der Regel am höchsten, wobei natürlich auf eine günstige Witterung zu achten ist. Die Datenerfassung im Feld erfolgt am einfachsten via NaturaList-App (Android) oder ornitho.de. Daten aus dem Rebhuhnmonitoring stehen dann natürlich auch für den neuen Brutvogelatlas ADEBAR 2 zur Verfügung. Im besten Fall beteiligen Sie sich über viele Jahre, da damit nicht nur die aktuelle Verbreitung, sondern auch Bestandstrends ermittelt werden können.
Interesse geweckt, selbst beim Rebhuhn-Monitoring mitzumachen? Ausführliche Informationen und Details gibt es hier. Freie Zählrouten in Ihrer Umgebung lassen sich über unsere Mitmachbörse finden. Dort können Sie Routen für sich reservieren lassen. Von den aktuell 650 Routen in NRW sind einige Dutzend momentan vakant. Auch die Anlage neuer Routen ist möglich. Wer mitmachen möchte, kann sich am besten direkt an Bettina Fels (LANUK) wenden.
22.01.2026
Start in die Spechtsaison 2026
Kaum eine Vogelgruppe ist so eng mit Wäldern verbunden wie die Spechte. Sie sind Indikatorarten für den Zustand dieses Lebensraums und als Baumeister des Waldes schaffen sie Brutplätze für viele andere Organismen, von Vögeln über Fledermäuse bis hin zu vielen Arthropoden. Ihr Hunger auf holzbewohnende Larven sorgt zudem dafür, dass sie eine weitere wichtige Rolle als Insektenfresser im Ökosystem Wald innehaben. Spechte haben nicht zuletzt oft faszinierende Lautäußerungen (Trommeln) und sind auch äußerlich echte Hingucker.
Umso wichtiger ist es, die Veränderungen im Bestand bei dieser Vogelgruppe möglichst genau zu überwachen. Aufgrund ihrer großen Reviere ist das aber über die normalen Standarderfassungsprogramme für häufige Arten gar nicht so einfach und mit möglichen Fehlern verbunden. Aus diesem Grund gibt es ein spezielles Spechtmonitoring. Die Erfassungen laufen als Modul des Monitorings seltener Brutvögel des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten und werden in NRW durch die NWO organisiert. Das Modul ist wenig aufwändig und erfordert lediglich zwei frühmorgendliche Begehungen in bestimmten Zeiträumen und in geeignetem Lebensraum, wobei eine Klangattrappe (ein Handy und ein Lautsprecher sind notwendig) eingesetzt wird. Feste Routen und Erfassungspunkte können unter Beachtung einiger kleiner Vorgaben selbst gewählt werden! Voraussetzung zum Mitmachen ist lediglich eine gute Kenntnis der heimischen Spechtarten inklusive ihrer Lautäußerungen. Routen sollten dabei nach Möglichkeit langfristig (d.h. über mehrere Jahre) erfasst werden. Bisher weist unser Routennetz in NRW noch Lücken auf: In der Mitmachbörse können Sie sich informieren, wo bereits gezählt wird. Zwar gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine freie Routen, aber fast überall, wo aktuell im Umfeld keine Routen vergeben sind, besteht natürlich großer Bedarf. Bisher sind in NRW immerhin 86 Routen vergeben, aber räumlich haben wir in NRW noch einige markante Lücken, von denen wir natürlich hoffen, dass wir sie mit Ihrer Hilfe in den nächsten Jahren schließen können.
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie Lust haben, mitzumachen. Mit Ihrer Hilfe können wir Trends bei dieser Vogelgruppe bestimmen und wichtige Wissenslücken schließen. Selbstverständlich stehen die erhobenen Specht-Daten auch für den neuen Brutvogelatlas ADEBAR 2 zur Verfügung.
Bundesweit war 2025 dank Ihres großen Engagements erneut ein sehr erfolgreiches Jahr für das Specht-Monitoring! Inzwischen sind bundesweit 1.700 Spechtrouten etabliert. Wenn Sie selbst bereits teilnehmen, aber die Daten aus dem letzten Jahr noch nicht übermittelt haben, freuen wir uns, wenn Sie dies noch nachholen.
Alle Details zum Programm inklusive einem Merkblatt sowie genaue Anleitungen zur Methodik in ornitho.de oder der NaturaList-App finden Sie hier. Um mitzumachen, bitten wir Sie, sich vor dem Start unbedingt per Mail an unsere Ansprechpartner zu wenden. Diese richten gerne gemeinsam mit Ihnen eine Route ein und beantworten alle vorhandenen Fragen. Die Buntspechte trommeln bereits eifrig und die Kartiersaison startet am 21. Februar – jetzt ist daher die beste Zeit, sich eine neue Route einzurichten und sich am MsB Spechte zu beteiligen!
16.01.2026
NWO-Seminare zur ADEBAR2-Erfassung
ADEBAR 2 geht ins zweite Jahr und die NWO bietet zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten an, um den Einstieg in die ADEBAR-Erfassung zu erleichtern.
In den kommenden Wochen bietet Ralf Joest, NWO-Koordinator für die ADEBAR 2-Kartierung in NRW, eine Reihe von Seminaren zur ADEBAR-Erfassung an. Dabei sind Vorträge, Exkursionen, Online-Seminare und eine (Halb-)Tagesveranstaltung. Das Angebot richtet sich an Einsteiger:innen, die mit der Vogelerfassung für ADEBAR 2 beginnen wollen. Für Fortgeschrittene besteht aber auch Raum für vertiefende Fragen und fachlichen Austausch.
Präsenz-Vortrag
ADEBAR 2, Ornitho und Naturalist! Wie kann ich bei der digitalen Vogelerfassung im Kreis Soest mitwirken? Donnerstag, 12. Februar 2026, 19:30 Uhr, Biologische Station der ABU Soest in Bad Sassendorf-Lohne (Teichstraße 19).
Online-Seminare per Webex-Meeting
ADEBAR, Ornitho und Naturalist! Wie kann ich bei der digitalen Vogelerfassung für ADEBAR 2 mitwirken? Freitag, 27. Februar 2026, 16:00 bis 18:00 Uhr. Freitag, 6. März 2026, 16:00 bis 18:00 Uhr.
Vor-Ort-Seminar mit Geländeübung – ADEBAR, Ornitho und Naturalist! Wie kann ich bei der digitalen Vogelerfassung für ADEBAR 2 mitwirken? Sonntag, 29. März 2026, 09:00 bis 14:00, Biologische Station der ABU Soest in Bad Sassendorf-Lohne (Teichstraße 19).
Exkursion
Vögel zählen im Brockbusch Einführung in die Geländearbeit für ADEBAR 2 und Co. Ostermontag, 06. April 2026, 09:00 Uhr, Erwitte-Norddorf.
Bitte melden Sie sich verbindlich an bei: Ralf Joest (joest@nw-ornithologen.de) Weitere Informationen zum Atlasprojekt finden Sie hier.
14.01.2026
60 Jahre Internationale Wasservogelzählung
Wir feiern Jubiläum: In diesem Jahr findet die 60. internationale Zählung rastender Wasservögel statt. Termin ist die Mittwinterzählung am kommenden Wochenende, dem 17./18. Januar.
Seit 1966/67 wird die Zählung der Wasservögel weltweit von Wetlands International organisiert – mittlerweile findet sie in rund 190 Staaten statt. Der International Waterbird Census ist Teil der Zählungen entlang der gesamten ostatlantischen Flugroute (dem sogenannten East Atlantic Flyway, der auch unsere Region umfasst). Der „Total Flyway Count“ findet alle drei Jahre statt und geht dieses Jahr in die fünfte Runde. Auch die europaweite Zählung der Schwäne findet an diesem Wochenende statt.
In NRW werden die Erfassungen durch die NWO organisiert, zum einen im Rahmen der Wasservogelzählung, zum anderen im Rahmen der Zählung der Gänse und Schwäne .
Mehre Hundert Gebiete werden durch eine dreistellige Zahl an Erfasser:innen gezählt. Sie werden nächstes Wochenende wieder ihr Spektiv schultern bzw. das Fernglas umhängen, um die genaue Zahl der Vögel zu ermitteln. Im Laufe der Jahrzehnte wurden weltweit rund 2 Milliarden Wasservögel in etwa 67.000 Gebieten erfasst.
Wer selbst zukünftig mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Diverse Zählgebiete sind vakant und gerne richten wir Ihnen auch ein neues Zählgebiet in Ihrer Region ein. Zusätzliche Hintergrundinformationen, methodische Details und Anleitungen finden Sie hier. Zum Jubiläum hat der DDA weitere Informationen und Links in einer aktuellen Meldung.
12.01.2026
Neuer Möwenrundbrief – Treffen und Pflegeeinsatz
Die AG Möwen trifft sich am 20./21.02 und sucht noch Zählende.
Möwen sind im Winterhalbjahr vor allem im Tiefland von NRW ein häufiger Anblick an Gewässern und in der offenen Landschaft. Sie verbringen die Nächte meist an Gemeinschaftsschlafplätzen, die oft seit vielen Jahren besetzt werden. Hier werden sie von Mitgliedern unserer AG Möwen im Rahmen der Schlafplatzzählungen erfasst.
Erfreulich ist, dass mit dem Aasee in Münster nun wieder Daten von einem wichtigen Zählgebiet in Westfalen vorliegen. Lücken in der Datenerfassung haben wir dagegen vor allem noch im Landesteil Nordrhein. Hier sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wer mitzählen möchte, kann sich gerne bei der AG Möwen melden. Die Schlafplatzzählung umfasst drei abendliche Zählungen im Jahr und benötigt daher nur einen überschaubaren Aufwand. Natürlich ist die Bestimmung einiger Großmöwen eine Herausforderung, andererseits ist das Artenspektrum sehr übersichtlich, so dass die Einarbeitung vergleichsweise schnell erfolgen kann. Im Rahmen abendlicher Zählungen ist auch nicht immer eine Erfassung auf Artniveau möglich bzw. gefordert. Je nach Zählgebiet ist aber oft ein Spektiv erforderlich.
Die Zählenden werden sich am 20./21.02. in Absprache mit der Biologischen Station Zwillbrocker Venn treffen und dort im Rahmen eines Pflegeeinsatzes die Brutinsel der Möwen freischneiden, so dass die Vögel zur Brutzeit wieder geeigneten Lebensraum vorfinden. Wer dort als Tagesgast mithelfen möchte, ist herzlich eingeladen. Bei Interesse am Pflegeeinsatz bzw. der Teilnahme an den Zählungen melden Sie sich bitte bei Jörg Hadasch an.
Weitere Informationen zur Schlafplatzzählung der AG Möwen und alle Rundbriefe finden Sie hier.
12.01.2026
Einladung zur Mitgliederversammlung und Jahrestagung der NWO
Die diesjährige Mitgliederversammlung und Jahrestagung der NWO findet am 01. März 2026 in der NUA in Recklinghausen statt. Ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Beiträgen erwartet alle ornithologisch Interessierten im Land!
Am Vormittag findet von 09:30 bis 11:00 Uhr unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt.
Nach einer Kaffeepause beginnt um 11:00 Uhr die Jahrestagung mit einem spannenden Programm. Bettina Fels wird zu Neuem aus der Vogelschutzwarte berichten. Nach dem Bericht der AviKom (Tobias Rautenberg und Daniel Hubatsch), bei dem uns tolle Fotos von der ein oder anderen Seltenheit ertwarten, geht es mit Bildern weiter: Das Vogelquiz (von Daniel Duff und Michael Schmitz) gehört mittlerweile zu unserer Tagung dazu und bietet allen die Möglichkeit, eigene Fähligkeiten in der Vogelbestimmung zu testen. Wie gewohnt wird es schöne Preise geben und natürlich jede Menge Ruhm, Ehre und die Erkenntnis, dass ausgerechnet die Art, an die man wahlweise als erstes oder zweites gedacht hat, die korrekte Auflösung gewesen wäre.
Wir freuen uns sehr, dass wir nach der Mittagspause mit Christoph Randler aus Tübingen einen exzellenten Redner von außerhalb gewinnen konnten. Er ist selbst nicht nur Birder, sondern lehrt auch an der Uni Tübingen. Er wird uns in seinem Vortrag auch ein bisschen den Spiegel vorhalten, sind Vogelbeobachtende doch seine bevorzugte soziologische Studiengruppe. Auf den neuesten Stand bei ADEBAR 2 wird uns im Folgenden Ralf Joest bringen, bevor Bruno Walther das sicherlich schon von vielen erwartete neue Steinkauz-Modul im Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel vorstellen wird.
Die beiden Abschlussvorträge sind zwei sehr charismatischen Vogelarten unseres Bundeslandes gewidmet: Christine Kowallik et al. entführen uns von den Brutgebieten der Zwerggänse in Schweden hin zu den Überwinterungsgebieten hier bei uns in NRW. Stefan R. Sudmann und Barbara Meyer stellen am Ende die provokante Frage, ob Ziegenmelker Scooter mögen.
Genügend Pausen bieten Zeit zum vogelkundlichen Austausch zwischendurch. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt (wir bitten um Spenden!). Die Einladung und das vollständige Programm kann hier heruntergeladen werden. Die Einladung erscheint außerdem im nächsten Charadrius-Heft. Gäste sind herzlich willkommen.