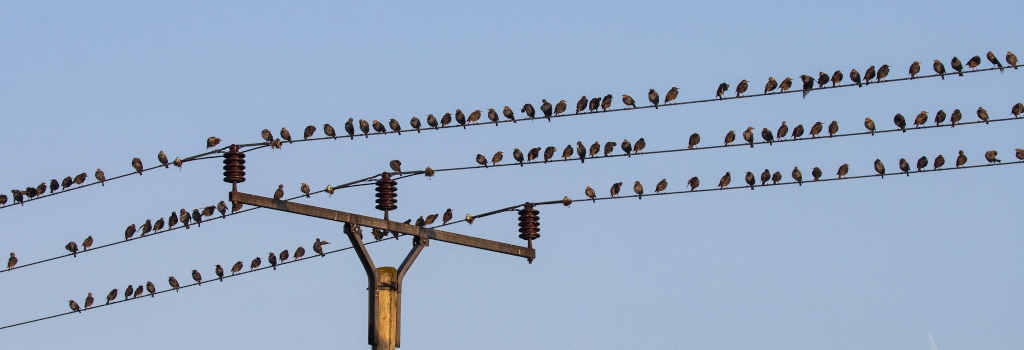NetBet Casino : Expérience de Jeu Équilibrée et Satisfaisante
NetBet Casino propose une plateforme complète avec des jeux variés, des promotions attractives et une interface intuitive. Idéal pour les joueurs en quête d’un casino fiable et accessible à tous les niveaux.
Cresus Casino VIP : Luxe, Style et Privilèges Exclusifs
Découvrez l’expérience premium de Cresus Casino VIP, un lieu dédié aux amateurs de gaming haut de gamme. Avec ses offres exclusives, son service personnalisé et ses jeux de qualité, ce casino attire les joueurs exigeants.
Jackpot Bob Avis : Une Plateforme Dynamique et Accessible
Jackpot Bob Avis présente une offre diversifiée avec des jeux captivants et des bonus réguliers. Ce casino en ligne convient parfaitement aux nouveaux joueurs comme aux habitués grâce à sa simplicité et son efficacité.
SpaceFortuna Casino : Univers Immersif et Graphismes Innovants
Rejoignez SpaceFortuna Casino, une plateforme originale qui mélange thèmes futuristes, animations interactives et jeux passionnants. Parfait pour ceux qui recherchent une expérience ludique différente et immersive.
GameTwist : Jeux Gratuits et Ambiance Décontractée
GameTwist est idéal pour ceux qui souhaitent s’amuser sans mise financière. Ce site propose des jeux gratuits, des graphismes colorés et une ambiance légère, parfaite pour jouer en toute détente.
Amon Casino : Un Mélange Équilibré de Fun et de Sécurité
Amon Casino vous invite à profiter d’une plateforme moderne et sécurisée. Grâce à ses jeux variés, ses bonus attractifs et son interface fluide, c’est une destination appréciée par les joueurs occasionnels et réguliers.
Golden Vegas : Jeux de Qualité et Bonus Attractifs
Explorez Golden Vegas, un casino en ligne raffiné proposant des machines à sous immersives, des jeux en direct et des promotions alléchantes. Idéal pour ceux qui recherchent une expérience élégante et captivante.
Aktuelle Meldungen
19.02.2026
Prädationsmanagement im Wiesenvogelschutz: Bruterfolgsmonitoring beim Großen Brachvogel
Neuer Artikel im Charadrius: Wiesenvögel sind eine der bedrohtesten Vogelgruppen Mitteleuropas. Für effektiven Schutz ist ein Bruterfolgsmonitoring wichtig. Deborah Harbring und Sascha Buchholz stellen Ergebnisse aus dem westlichen Münsterland vor, die im Rahmen eines Life-Projektes gewonnen wurden. Sie bringen ihre Ergebnisse in der folgenden Zusammenfassung auf den Punkt.
„Prädationsmanagement in Offenlandschutzgebieten wird mit Intensivierung der Landnutzung immer bedeutsamer im Naturschutz. Der steigende Prädationsdruck gegenüber bodenbrütenden Vogelarten ist ein weitreichendes Problem geworden. In dieser Studie geht es um das EU-Projekt „LIFE Wiesenvögel NRW“ und dessen Umsetzung in einem Naturschutzgebiet im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen. Das Untersuchungsgebiet ist ein 250 ha großes Teilgebiet des NSG „Amtsvenn und Hündfelder Moor“ und wird als „Amtsvenn-Süd“ bezeichnet. Im Rahmen des LIFE-Projekts wurden Maßnahmen zur Lebensraumoptimierung für den Großen Brachvogel Numenius arquata und weitere Wiesenlimikolen getroffen. Zu den Maßnahmen gehören die Entfernung von Gehölzen, Freilegung von Blänken, Anpassung der Grünlandbewirtschaftung sowie Prädationsmanagement. Die Untersuchung bezieht sich auf die Daten aus dem Brutvogelmonitoring des Großen Brachvogels im Jahr 2023. Es wurde festgestellt, dass 57 % der 23 Gelege vor dem Schlupf prädiert wurden (9 % Verluste durch Viehtritt). Hauptprädator war der Rotfuchs mit einem Anteil von 46 %, gefolgt von Marderartigen mit einem Anteil von 31 %. Elektrozäune zur Abwehr von Prädatoren hatten einen positiven Effekt auf den Bruterfolg. Die Nutzungstypen Mähwiese, Mähweide und Weide wurden hinsichtlich des Bruterfolgs verglichen. Dabei wurde ermittelt, dass Mähweiden den höchsten Schlupferfolg hatten und Weiden keinen. Außerdem wurde ein signifikanter Zusammenhang zwischen der durchschnittlichen Vegetationshöhe um das Gelege und dem Schlupferfolg ermittelt. Schließlich werden Maßnahmen im Prädationsmanagement diskutiert, die zum Erhalt der lokalen Brachvogel-Population beitragen können.“
Der Charadrius mit diesem und weiteren Beiträgen ist für Mitglieder kostenlos, kann aber auch zum Preis von 18,00 € pro Heft + Porto bei der Geschäftsstelle bezogen werden. Auch Neumitglieder erhalten das Heft zusammen mit den beiden aktuellen Bänden „Vögel in Deutschland“ (solange der Vorrat reicht). NWO-Mitglied werden lohnt sich!
12.02.2026
Die Rückkehr des Fischadlers nach Nordrhein-Westfalen
Neuer Artikel im Charadrius: Seit Jahrzehnten war der Fischadler in NRW ausgestorben. Nun konnte erstmals wieder eine erfolgreiche Brut dokumentiert werden. Michael Jöbges und seine Kollegen fassen die Ergebnisse wie folgt zusammen.
„Zusammenfassend wird die erste erfolgreiche Brut des Fischadlers seit 1930 in Nordrhein-Westfalen dokumentiert. Der Brutplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe zu etablierten Brutstandorten der Art am Steinhuder Meer und am Dümmer in Niedersachsen. Das Nest wurde in einen künstlichen Nistkorb auf einem Strommast gebaut, der bereits 1993 angebracht worden war. Nach Brutversuchen in den Jahren 2023 und 2024 wurde 2025 eine erfolgreiche Brut (ein flügges Jungtier) verzeichnet. Um Störungen zu vermeiden, wurde die Umgebung des Nistplatzes durch Straßensperren weiträumig geschützt. An den Krickenbecker Seen, nahe der niederländischen Grenze im Kreis Viersen, wurden Fischadler, die eine künstliche Nistplattform besuchten, von 2023 bis 2025 mit Hilfe einer Wildkamera intensiv beobachtet. Nestbauaktivitäten und Paarungen wurden aufgezeichnet, aber bisher wurde kein Brutversuch beobachtet. Anhand der Gefiedermerkmale konnte beobachtet werden, dass mehrere Individuen die Nistplattform besuchten, darunter beringte Individuen aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Großbritannien, Spanien und Russland. Eine Brut scheint hier in näherer Zukunft nicht ausgeschlossen und passt gut zu den Ansiedlungen in den benachbarten Niederlanden.“
Der Charadrius mit diesem und weiteren Beiträgen ist für Mitglieder kostenlos, kann aber auch zum Preis von 18,00 € pro Heft + Porto bei der Geschäftsstelle bezogen werden. Auch Neumitglieder erhalten das Heft zusammen mit den beiden aktuellen Bänden „Vögel in Deutschland“ (solange der Vorrat reicht). NWO-Mitglied werden lohnt sich!
09.02.2026
Für ADEBAR und Vogelmonitoring – Mit zwei Spaziergängen pro Jahr Brutvögel der Bäche und Flüsse erfassen
Eisvögel, Wasseramseln und Gebirgsstelzen sind typische Bewohner schnell fließender Bäche und Flüsse. Ihre Brutverbreitung ist entsprechend nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt, sondern sie kommen linear in der Landschaft vor, was ein spezielles Monitoring erfordert.

Eisvogelbestände waren lange Zeit gefährdet, in den letzten Jahrzehnten haben sich die Bestände bei uns aber wieder stabilisiert. Kalte Winter überleben viele Individuen jedoch nicht. Gebirgsstelzen gelten als ungefährdet und sind in NRW weit verbreitet, kommen aber ebenfalls schwerpunktmäßig an Fließgewässern vor. Wasseramseln sind in der Verbreitung dagegen bei uns nahezu ausschließlich auf die Mittelgebirge beschränkt. Mindestens lokal dürfte es deutliche Bestandsabnahmen gegeben haben.
Für ADEBAR 2 sollten vollständige bzw. unvollständige Listen für diese Arten entlang von Fließgewässern erhoben werden. Im Februar lohnt es bereits, sich auf die Suche nach Wasseramseln zu machen. Sie gehören zu den Arten, die sehr früh im Jahr brüten, bereits jetzt Reviere besetzt haben und mit dem Nestbau beschäftigt sind. Für die beiden anderen Arten sind spätere Termine besser.
Langfristig angelegt ist das Binnengewässermodul im Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel (MsB BiG), das wir intensiv ausbauen möchten. Wer an Bächen und Flüssen mit den drei Hauptzielarten kartiert, kann bereits mit zwei Begehungen im Jahr mitmachen! Voraussetzung ist lediglich, die drei Arten visuell und akustisch sicher zu bestimmen. Perfekt sind Wege entlang des Gewässers, zudem kann von Brücken aus geschaut werden, an denen nicht selten Gebirgsstelze und Wasseramsel sogar brüten. Die beiden Begehungen finden morgens Ende März/Anfang April und im Mai statt. Die Dateneingabe erfolgt am einfachsten bequem per NaturaList-App. Daten aus dem MsB stehen auch automatisch für ADEBAR 2 zur Verfügung. Untersuchungsgebiete richten wir gerne mit Ihnen gemeinsam ein! An übersichtlichen Stillgewässern wie Parkteichen und wenn weitere Arten im Fokus stehen, wird das BiG mit drei Begehungen durchgeführt und ist dann ebenfalls einstiegsgeeignet.
Alle wichtigen Informationen gibt es hier. Wer mitmachen möchte bzw. noch Fragen hat, kann sich gerne melden (info@nw-ornithologen.de)!
08.02.2026
Neuer Charadrius und Vögel in Deutschland
Unser neuer Charadrius, Heft 1 des 62. Jahrgangs, ist soeben erschienen. In den nächsten Tagen sollte es bei allen Mitgliedern angekommen sein. Als besonderen Bonus erhalten unsere Mitglieder außerdem die beiden aktuellsten Bände der Reihe „Vögel in Deutschland“, die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten und seinen Partnern herausgegeben wird.
Der neue Charadrius ist 80 Seiten stark und enthält vier Originalartikel. Michael Jöbges et al. dokumentieren die erfreuliche Rückkehr des Fischadlers nach Nordrhein-Westfalen. Im zweiten Artikel berichten Deborah Harbring und Sascha Buchholz über das Prädationsmanagement im Wiesenvogelschutz am Beispiel des Großen Brachvogels. Die Avifaunistische Kommission präsentiert den reich bebilderten Bericht über seltene Vogelarten in NRW im Jahr 2023. Vielleicht haben auch Sie eine Seltenheit dokumentiert und finden sich in diesem Beitrag wieder. Der Abschlussartikel widmet sich dem Rastvogelmonitoring: Christine Kowallik und Kolleg:innen befassen sich in ihrem Artikel mit Rastbeständen von Gänsen in NRW in den Wintern 2010/11 bis 2024/25.
Der Charadrius enthält außerdem die aktuellen NWO-Mitteilungen Nr. 62 mit zahlreichen Beiträgen aus dem Verein und darüber hinaus. Beachten Sie, dass das Heft auch die Einladung zu unserer Mitgliederversammlung und Jahrestagung am 01. März enthält.
Wir freuen uns sehr, dass es uns möglich war, dieses Mal wieder zwei Bonus-Hefte aus der Reihe „Vögel in Deutschland“ für unsere Mitglieder beizulegen. Es handelt sich um das im Dezember erschienene Heft zur Bestandssituation der „Vögel in Deutschland“, das im Rahmen des letzten Vogelschutzberichtes der Europäischen Union erstellt wurde. Bis zum Erscheinen von ADEBAR 2 wird es das Referenzwerk für Brutbestände in unserem Land sein und daher für Viele von großem Interesse sein. Das zweite Heft ist nicht minder interessant und wurde erst vor wenigen Tagen gedruckt. Es ist das Schwerpunktheft zu ADEBAR 2 und daher eine wichtige Grundlage für das wohl aktuell wichtigste avifaunistische Projekt bei uns.
Der Charadrius ist für Mitglieder kostenlos, kann aber auch zum Preis von 18,00 € pro Heft + Porto bei der Geschäftsstelle bezogen werden. Aktive im Monitoring und Kartierende bei ADEBAR 2, die die Hefte „Vögel in Deutschland“ noch nicht erhalten haben, erhalten diese bei unseren Veranstaltungen (so lange der Vorrat reicht). Neumitglieder bekommen die Hefte im Rahmen eines Begrüßungspaketes zugeschickt. Es lohnt sich also, jetzt Mitglied zu werden!
06.02.2026
Neues Modul im Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel
Der Steinkauz ist eine der Charakterarten der Tiefländer Nordrhein-Westfalens. Mit schätzungsweise 50 bis 60 % des bundesdeutschen Bestandes trägt NRW eine besondere Verantwortung für diese Art. Als typische Leitart strukturreicher Kulturlandschaften wie Streuobstwiesen, Weiden und extensiv genutzter Offenlandbereiche steht der Steinkauz zugleich für den Erhalt ortsnaher Lebensräume. Er ist zudem der Logovogel der NWO. Wie bei anderen Eulenarten auch fehlte bisher ein spezielles Monitoring, das modernen methodischen Standards genügte. Das hat sich nun geändert!
Bestände und ihre Veränderungen beim Steinkauz und anderen Eulenarten sind aufgrund der nächtlichen Lebensweise kaum ohne spezielle Methodik nachzuweisen. Gleichzeitig werden vielerorts Steinkäuze, aber z.B. auch Schleiereulen, seit langer Zeit intensiv durch Nisthilfen unterstützt. Vor diesem Hintergrund konnte nun ein neues Modul im Rahmen des Monitorings seltener Brutvögel etabliert werden, das sich speziell den Eulen widmet.
Zielarten dieses neuen Brutbestandsmonitorings sind neben Steinkäuzen auch die anderen regelmäßig bei uns brütenden Eulenarten Schleiereule, Uhu, Waldkauz und Waldohreule. Für die Kleineulen Sperlingskauz und Raufußkauz existiert bereits ein eigenes Modul im Rahmen des MsB, das allerdings ebenfalls noch weitere Unterstützung benötigt.
Das nun implementierte Eulen-Modul ist zweigeteilt und sieht die Erfassung mittels Klangattrappen und/oder Nistkastenkontrollen vor. Aufgrund einer hohen Flexibilität können so auch lokale langjährig bestehende Untersuchungsreihen fortgesetzt werden. Gleichzeitig können für einzelne Revierstandorte (Niströhren) auch Daten zum Bruterfolg gespeichert und ausgewertet werden, so dass die Möglichkeiten über die vieler anderer Monitoring-Module hinausgehen. Die selbst zu wählenden Untersuchungsgebiete sind in der Regel vergleichsweise groß, können also beispielsweise Viertel- oder Sechzehntelquadranten der Topographischen Karte 1:25.000 umfassen. Auch mehrere Untersuchungsgebiete können ausgewählt werden, falls z.B. ein sehr großes Gebiet wie weite Teile eines Kreises erfasst wurden. Gerade für Arten wie Waldohreule und Waldkauz sind auch leicht abzugrenzende Waldbereiche und andere unregelmäßig geformte Gebiete sinnvolle Probeflächen. Die Dateneingabe erfolgt wie gewohnt bequem über einen speziellen Bereich in der NaturaList-App (Android-Smartphone), der erst nach Freischaltung durch uns verfügbar ist. Der Mehraufwand ist im Feld bei Nistkastenkontrollen also überschaubar, sobald einmal die Niströhren erfasst worden sind. Für die Kartierung ohne Nistkastenkontrollen ist die Klangattrappe bereits in die App intergriert, so dass lediglich ein externer Lautsprecher notwendig ist.
Die meisten Steinkauz- und Schleiereulen-Expert:innen, die Nistkästen kontrollieren bzw. Jungvögel beringen, haben wahrscheinlich schon vom neuen Modul gehört. Wir bitten Sie, sich mit unserem Ansprechpartner in Verbindung zu setzen, damit auch Sie Daten aus Ihrem Gebiet zukünftig digital übermitteln können. Bei den anderen Eulenarten oder dort, wo es noch keine intensive Steinkauz-/Schleiereulenbetreuung gibt, sind alle Interessierten aufgerufen, sich intensiv am Monitoring zu beteiligen.
Selbstverständlich stehen die Daten aus dem Modul auch unmittelbar für ADEBAR 2 zur Verfügung und unterstützen den Vogelschutz, da die Informationen beispielsweise auch in den Vogelschutzbericht oder Rote Listen eingehen können. Ausführliche Informationen und der Kontakt für weitere Fragen finden sich hier . Wir bedanken uns bei allen Eulenschützer:innen, die die Implementierung des Moduls unterstützt haben. Die fachliche Begleitung erfolgte durch den Dachverband Deutscher Avifaunisten. Die Einrichtung des Moduls wurde dankenswerterweise finanziell vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW unterstützt.
05.02.2026
Vortrag der Kartiergemeinschaft Wahner Heide im Kölner Zoo
Unsere Regionalgruppe, die Kartiergemeinschaft Wahner Heide (KGW), erfasst seit langer Zeit die Vogelwelt in einem der artenreichsten Gebiete Nordrhein-Westfalens. Am 10.02. um 18:30 Uhr präsentiert sie für den Kölner Zoo einen Vortrag, bei dem Region und Vogelwelt vorgestellt werden.
In weitem Umkreis gibt es kein Gebiet mit einer so reichhaltigen Fauna an terrestrischen Vogelarten, hinzu kommen unzählige hochgradig bedrohte Wirbeltiere über die Vögel hinaus, seltene Wirbellose wie eine in NRW kaum erreichte Zahl an Wildbienenarten, typische Moorlibellen und zahlreiche Schmetterlinge und bedrohte Pflanzen. Die Vogelwelt des Gebietes umfasst Bewohner offener Heidegebiete wie Schwarzkehlchen und Heidelerche, Arten der halboffenen Landschaft wie Baumpieper, Neuntöter und Orpheusspötter lassen sich ebenfalls zuverlässig beobachten. Im Grünland dominieren Wiesenpieper und Feldlerche, die andernorts bereits selten geworden sind. In den Wäldern leben heimliche Greifvögel wie der Wespenbussard, abends balzen Waldschnepfen und in manchen Jahren lassen sich alle in NRW aktuell heimischen Spechtarten beobachten. An den Gewässern der Wahner Heide leben zudem Wasserralle und Rohrammer, an der Agger sind Eisvögel und viele andere nicht selten.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Der Vortrag kann sowohl in Präsenz besucht werden, als auch online via Zoom verfolgt werden. Die Details zur Anmeldung finden Sie auf den Seiten des Kölner Zoos.
Die Kartiergemeinschaft Wahner Heide sucht übrigens immer erfahrene Kartierende, die helfen, die artenreiche Vogelwelt der Wahner Heide alljährlich zu erfassen. Bei Interesse finden Sie hier weitere Informationen.
04.02.2026
Neue Meldeliste für die Dokumentation von Seltenheiten bei der AviKom
Die Beobachtung seltener Vogelarten sind nicht nur das Salz in der Suppe der Vogelbeobachtung, ihre Dokumentation zeigt spannende Veränderungen in der Vogelwelt auf. Einst extrem seltene Arten tauchen heute häufiger auf, andere werden vom Brutvogel zur absoluten Ausnahmeerscheinung.
Aus diesem Grund wird auch die Meldeliste unserer Avifaunistischen Kommission (AviKom) regelmäßig angepasst, um aktuellen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Dies soll zukünftig in regelmäßigen Abständen von fünf Jahren passieren, so dass zwischendurch gleichzeitig auch eine gewisse Konstanz gewahrt bleibt, auf die sich Beobachtende einstellen können. Vorher aber wurde die Meldeliste nun noch einmal angepasst. Dies geschah rückwirkend zum 01.01.2025.
Die Änderungen sind überschaubar, nichts destotrotz betreffen sie einige gut bekannte und charismatische Arten. Neu „meldepflichtig“ sind Nebelkrähe, Wanderfalken der Unterart Falco peregrinus calidus und Karmingimpel. Gerade die Bestimmung der ersten beiden ist nicht einfach, da es bei Nebelkrähen oft Hybriden gibt und phänotypisch eindeutige hochnordische Wanderfalken über ein „mit Merkmalen von“ hinaus erstaunlich selten dokumentiert worden sind. Nicht mehr dokumentiert werden müssen Eistaucher, Kuhreiher, Steppenweihe und Raubseeschwalbe. Hier gelingen mittlerweile so regelmäßig Beobachtungen, dass zumindest bis auf Weiteres von einer Einreichung bei der AviKom abgesehen werden kann. Noch nicht eingereichte Beobachtungen bis zum 31.12.2024 sollten aber unbedingt nachgereicht werden. Und selbstverständlich sollten Beobachtungen dieser nicht meldepflichtigen Arten auch weiterhin auf ornitho.de dokumentiert werden. Hier ist es ausdrücklich erwünscht, Belegfotos hochzuladen und eine sorgfältige Beschreibung im Bemerkungsfeld zu hinterlegen, die die Beobachtung eindeutig macht und eine Verwechslung ausschließt. Bitte schreiben Sie dort nicht nur, dass Sie eine Art kennen, sondern geben Sie die tatsächlich von Ihnen festgestellten Merkmale an.
Die aktuelle Meldeliste kann hier heruntergeladen werden. Wir drücken die Daumen, dass auch Sie Glück haben und die ein oder andere Ausnahmeerscheinung in nächster Zeit beobachten können.
02.02.2026
Welttag der Feuchtgebiete
Heute ist Welttag der Feuchtgebiete. Am 02. Februar 1971 wurde in der iranischen Stadt Ramsar das Übereinkommen über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, unterschrieben. Deutschland trat fünf Jahre später bei und feiert im Jahr 2026 die 50-jährige Unterzeichnung.
Feuchtgebiete gehören zu den produktivsten Lebensräumen der Erde, sie halten das Wasser für Trockenzeiten, wirken mäßigend auf das Klima, speichern CO2, sind Erholungsräume, essentiell für Land- und Forstwirtschaft und vor allem Hotspots der Artenvielfalt. Weltweit nimmt die Zahl der Feuchtgebiete durch menschlichen Einfluss leider immer weiter ab und viele sind stark geschädigt.
In NRW wurden drei Gebiete als Ramsargebiet von internationaler Bedeutung gemeldet: der Untere Niederrhein, die Rieselfelder Münster und die Staustufe Schlüsselburg. Blicken wir auf den Zustand der Feuchtgebiete in unserem Bundesland insgesamt, wurden auch bei uns Moore großräumig entwässert, Flüsse begradigt und noch so kleine Feuchtstellen, Tümpel und Teiche sind trockengelegt worden und der Grundwasserspiegel wurde fast überall abgesenkt. Das alles sind Prozesse, die keineswegs überall gestoppt wurden und die Klimakrise ist als weiterer Gefährdungsfaktor hinzugekommen.
Auf den Roten Listen finden sich daher wenig überraschend viele Feuchtgebietsbewohner wie die Bekassine in den höchsten Kategorien wieder. Bekassinen waren einst fast flächendeckend als Brutvögel bei uns verbreitet und fehlten auch im Mittelgebirge nicht. Heute leben in NRW nur noch wenige Brutpaare in wenigen sehr nassen Mooren und Feuchtwiesen.
Die gute Nachricht ist, dass Wiedervernässungen und Renaturierungsprojekte nicht selten schon nach kurzer Zeit Erfolg haben und manche bedrohte Art rasch wiederkommen kann. Leider sind es noch viel zu wenige Projekte und die Umsetzung erfolgt oft nicht konsequent genug. Die Flächen sind dementsprechend oft zu klein, um den hochgradig bedrohten Arten besser zu helfen. Bei einigen Arten hält die Bestandsabnahme daher weiter an oder eine Wiederbesiedlung, wie sie in benachbarten Regionen längst stattgefunden hat, bleibt in NRW aus. Es bleibt also viel zu tun!
Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich an unseren Monitoringprogrammen beteiligen, die wichtige Grundlagen über den ökologischen Zustand unserer Gewässer und iherer Bewohner liefern. Das Monitoring seltener Brutvögel der Binnengewässer ist gerade in überschaubaren Gebieten wie Seen und Parkgewässern ein ideales Einstiegsmodul, an Fließgewässern lassen sich Eisvogel, Wasseramsel und Gebirgsstelze bereits mit zwei Spaziergängen im Frühjahr erfassen. Jetzt ist die richtige Zeit, sich dazu bei uns zu melden, denn die Zählsaison startet in Kürze. Wer lieber Rastvögel erfassen möchte, kann sich beispielsweise an der Wasservogelzählung beteiligen. Der Schwerpunkt der Erfassungen liegt von September bis April, aber ein Einstieg ist jederzeit möglich. Scheuen Sie sich nicht, sich bei uns zu melden!